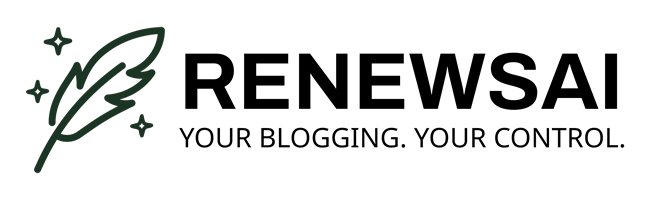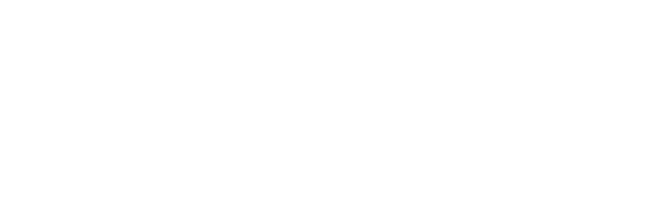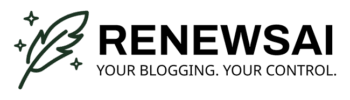Mitten in Berlin, zwischen sanierten Altbauquartieren, Luxuslofts und steigenden Mieten, steht ein unscheinbares Mehrfamilienhaus in der Nähe des Tempelhofer Felds. Es sieht aus wie viele andere – doch es ist Eigentum von niemandem. Oder genauer gesagt: Es gehört sich selbst, verwaltet von einem gemeinnützigen Kollektiv, dem Berliner Community Land Trust (CLT). Keine Einzelperson, kein Konzern, keine Genossenschaft besitzt den Boden unter dem Gebäude. Stattdessen liegt er in einem Treuhandverhältnis – und ist damit dem Markt entzogen. Willkommen in einer leisen Revolution gegen Spekulation, Gentrifizierung und Bodenverwertung.
Das Prinzip: Land ohne Eigentümer
Ein Community Land Trust (CLT) ist ein gemeinnütziges Modell, bei dem Grund und Boden dauerhaft in einer unabhängigen Stiftung oder einem Verein verbleibt. Gebäude auf diesem Boden können genutzt, gebaut oder renoviert werden, aber das Land selbst wird nie verkauft. Mieter oder auch Nutzer*innen erwerben ein langfristiges Nutzungsrecht – oft über 99 Jahre –, das aber keine klassische Eigentumsübertragung beinhaltet. Dadurch wird verhindert, dass Boden als Spekulationsobjekt dient oder für kurzfristige Kapitalgewinne veräußert werden kann.
Das Modell stammt ursprünglich aus den USA, wo 1969 der erste CLT im ländlichen Georgia von afroamerikanischen Bürgerrechtlern gegründet wurde. Heute gibt es über 250 aktive Land Trusts allein in den Vereinigten Staaten, darunter große Projekte wie das Dudley Street Neighborhood Initiative in Boston. In Europa ist das Modell jünger – aber rasant wachsend.
Berlin: Die stille Transformation des Markts
In Berlin wurde 2021 der erste CLT gegründet: „Stadtbodenstiftung“ nennt sich die Organisation, die heute bereits über 3.000 m² Boden in Kreuzberg, Neukölln und Wedding hält. Die Stiftung wird durch Spenden, Erbpachtverträge und gemeinwohlorientierte Investitionen getragen. Ein konkretes Beispiel ist das Wohnprojekt „AmMa65“ in der Nähe der Hermannstraße: ein ehemaliges Mietshaus mit 15 Wohneinheiten, das durch eine lokale Initiative 2022 aus der Zwangsversteigerung herausgekauft wurde – mit Unterstützung der Stiftung. Heute zahlen die Bewohner:innen dort eine Miete von rund 7,20 € pro Quadratmeter, weit unter dem Berliner Durchschnitt von 11,54 € (Stand 2025, laut Mietspiegel).
Die Besonderheit: Mieter:innen sind in einem demokratisch organisierten Nutzer:innenrat vertreten. Über Modernisierungen, Neuvergaben oder Gemeinschaftsnutzungen wird kollektiv entschieden. Profite werden reinvestiert, nicht ausgeschüttet. Es geht um Erhalt, nicht um Verwertung.
Genf: Rechtliche Pionierarbeit und städtische Allianzen
Auch in Genf hat sich das Konzept etabliert. Bereits 2017 wurde dort der „Fondation CLT Genève“ ins Leben gerufen – unterstützt von der Stadtverwaltung, mehreren Sozialwohnungsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Initiativen. Bis 2024 konnten sieben Grundstücke mit insgesamt über 180 Wohneinheiten in den Trust eingebracht werden. Die Stadt stellt in manchen Fällen Erbpachtrechte für 99 Jahre bereit, oft zu symbolischen Preisen. Die Voraussetzung: dauerhafte Gemeinnützigkeit und Nichtveräußerbarkeit.
Ein Bericht des Schweizer Bundesamts für Wohnungswesen aus dem Jahr 2024 nennt das Genfer Modell „eines der effizientesten Instrumente gegen urbane Verdrängung“. Die durchschnittliche Miete in Genf liegt bei über 1.500 CHF für eine Zwei-Zimmer-Wohnung; in CLT-gebundenen Häusern dagegen zwischen 800 und 950 CHF – ohne Subvention.
Statistik gegen das Marktversagen
Die Wirkung ist messbar. In einer Vergleichsstudie der Universität Zürich aus dem Jahr 2023 wurden 37 europäische Wohnprojekte analysiert, davon 11 CLT-gebunden. Die Mietsteigerung lag bei CLTs im Zeitraum 2017–2022 im Schnitt bei 1,2 % pro Jahr, bei regulären Mietverhältnissen bei 3,9 %. Zudem zeigten CLTs eine um 46 % höhere Bewohnerzufriedenheit, gemessen an Kriterien wie Mitbestimmung, Nachbarschaftsbindung und subjektiver Sicherheit.
Auch ein Blick auf die soziale Durchmischung ist aufschlussreich: In Berliner CLTs leben über 40 % Personen mit Migrationshintergrund, etwa doppelt so viele wie im städtischen Durchschnittsbestand. Die Altersverteilung ist ebenfalls deutlich breiter gefächert – vom Studenten bis zur Rentnerin.
Herausforderungen: Finanzierung, Rechtsform, Politik
So vielversprechend das Modell ist – es stößt an strukturelle Grenzen. Die Finanzierung der Anfangsinvestition bleibt schwierig, besonders in Großstädten mit hohem Bodenwert. Der Zugang zu Grundstücken ist oft durch Ausschreibungen und Privatisierungen blockiert. Zudem fehlt in vielen Ländern ein spezifischer Rechtsrahmen, der CLTs als eigenständige Form anerkennt – in Deutschland gelten sie teils als Stiftung, teils als Verein, teils als GbR.
Trotzdem wächst die Bewegung. In Frankreich wurde 2023 ein nationales CLT-Förderprogramm aufgelegt. In Österreich entstehen in Wien und Graz erste Pilotprojekte. In Deutschland wird im Bundestag eine „Gemeingut-Boden-Initiative“ debattiert, die eine Bodenwertsteuer und CLT-Erbpachtmodelle kombinieren möchte. Unterstützt wird sie von einem breiten Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen und zivilgesellschaftlichen Gruppen.
Mehr als Wohnen: Eine Frage der Demokratie
Community Land Trusts sind keine Wohnbauprojekte im klassischen Sinn. Sie sind Ausdruck einer anderen Sicht auf Eigentum – und letztlich auf Demokratie. Indem sie den Boden dem Markt entziehen, entziehen sie ihn auch der spekulativen Machtkonzentration. Sie stellen eine Rückführung des Grundsätzlichen dar: dass Raum zum Leben ein Recht ist, kein Produkt.
In einer Zeit, in der Wohnungsmärkte kollabieren, Städte sich entmischen und der Glaube an soziale Gerechtigkeit bröckelt, bieten CLTs nicht nur Schutz vor Verdrängung. Sie bieten eine strukturelle Alternative – konkret, funktionierend, machbar.